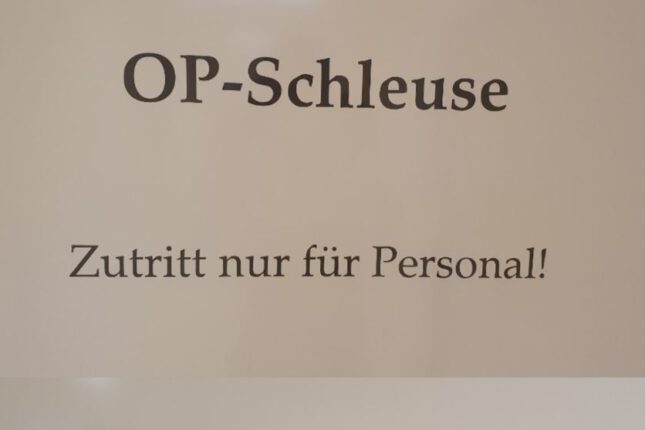Der 5. Juni 2020 war der Tag, an dem ich zum ersten Mal die Seiten gewechselt habe. Am Abend davor hatte ich mit Bauchschmerzen im Bett gelegen. Ich dachte da nur, dass ich abends wohl zu viel gegessen hatte. Nach einiger Zeit gingen die Schmerzen immer mehr zurück. Nur noch ein leicht rechtsziehender Seitenschmerz blieb. Da ich schon zwei Mal an Nierensteinen gelitten hatte und der Schmerz sich ähnlich anfühlte, dachte ich an einen dritten Nierenstein.
So ging ich am nächsten Morgen zur Arbeit und klagte mein Leid der Nacht meinen Kollegen. Wie verantwortungsvolle Kollegen das so machen, überredeten sie mich zu einer Untersuchung in der Notaufnahme. Die Laborwerte ergaben, dass ich völlig gesund war, der Tastbefund war ebenfalls unauffällig. Allein der Ultraschall meines Bauches ergab den Befund Appendizitis (Blinddarmentzündung). Ich wollte dem nicht wirklich Glauben schenken und bestand auf einer Zweitmeinung. Leider bestätigte unser Chefradiologe den Befund.
Der Anfang meines Rollenwechsels
Von diesem Zeitpunkt an übernahm ich die Rolle des Patienten. Ich fing zunächst eine Diskussion über die Notwendigkeit einer Operation an. Schließlich wollte ich über das Wochenende nach Dresden auf einen Junggesellenabschied fahren. Und die Tatsache, dass ich stattdessen im Krankenbett liegen würde, löste in mir ein Gefühl von Widerwillen, Hilflosigkeit und Enttäuschung aus. Aus lauter Verzweiflung lief mir sogar eine Träne hinunter, die aber glücklicherweise von meiner Kollegin aus der Notaufnahme in Form einer Umarmung aufgefangen wurde.
Im selben Augenblick kam die Oberärztin, die mich operieren sollte. Sie wollte sich nochmal selbst vom Befund überzeugen. Als ich so auf der Liege lag, die Oberärztin rechtsseitig drückte und ich dabei einen klaren Abwehrschmerz spürte, war klar, dass ich heute nicht mehr nach Hause kommen würde. Ich würde bald auf dem Operationstisch liegen.
Es kamen noch größere Notfall-OPs dazwischen und ich rutschte in der Warteliste weiter nach hinten. Als Mitarbeiter hat man gemischte Gefühle dabei. Einerseits hatte ich natürlich Verständnis. Andererseits hatte ich gehofft, als Mitarbeiter gewisse Vorzüge zu genießen. Besonders gefreut habe ich mich dann über mein schönes und ruhiges Zimmer in der Klinik.
Die Wartezeit und ihr Ende
Ich habe die Wartezeit genutzt, bin nach Hause gefahren, um meine Tasche zu packen und meine Familie zu informieren. Um mir die Zeit zu vertreiben, schaute ich auf meiner Heimatstation vorbei. Mein OP-Termin war auf 23 Uhr festgelegt worden. Die Zeit verging nur sehr langsam und mich quälten viele Gedanken. Wird es Komplikationen geben? Funktioniert die Narkose? Wird mir schlecht nach der Narkose sein? Und vor allem, wie lange lasse ich meine Kollegen im Stich?
Fremd und falsch
Um 4 Uhr morgens war ich endlich an der Reihe. Meine erste OP in Vollnarkose sollte jetzt starten. Allein die Fahrt zur OP-Schleuse war völlig merkwürdig, da ich es war, der im Bett lag und nicht das Bett schob. Es fühlte sich fremd und falsch an. Ich wurde zunächst in den Überwachungsraum gebracht, weil ich noch über die Narkose aufgeklärt werden musste. Wenn man die ganzen Komplikationen so hört, dann möchte man am liebsten aufstehen und gehen. Ich merkte, dass sich in mir ein Gefühl der Panik breit machte: Ich fühlte mich komplett hilflos und musste mein Leben in andere Hände geben. Für mich ein seltsames Gefühl, denn ich bin ein Mensch, der gern alles unter Kontrolle hat.
So schlief ich nun ein – und als ich wieder aufwachte, war alles vorbei. Ich lag im Überwachungsraum. Dort habe ich erst einmal ein Schmerzmittel bekommen, bevor ich zurück auf die Privatstation durfte.
Neue Herausforderung
Kurz danach sah ich mich einer neuen Herausforderung gegenüber. Ich musste auf die Toilette. Natürlich wollte ich als Mitarbeiter nicht klingeln. So habe ich mich mit einer hohen Dosis an Schmerzmitteln und viel Zeit selbst mobilisiert. Das habe ich auch meiner Kollegin, Freundin und Pflegebotschafterin Mandy Crawford zu verdanken, die mich mit Schmerzmitteln versorgte. Ich habe versucht, alles alleine zu bewältigen, wie zum Beispiel die Infusionen an- und abzumachen, den Toilettengang, das Eingeben meiner Essenswünsche und vieles mehr. Ich wollte auf gar keinen Fall zur Last fallen und der typische Klingelpatient werden. So verließ ich nach anderthalb Tagen die Klinik und hinterließ als Dankeschön einige Päckchen Schokolade für das Team. Mein Fazit der Geschichte ist: Du kannst dein Leben nicht kontrollieren, das Leben kontrolliert dich.
Foto: Wjatscheslaw Schäfer